Wissensorientierte Unternehmensführung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Cover.jpg|mini|link=https://amzn.to/44YDr6Z]] | [[Datei:Cover.jpg|mini|link=https://amzn.to/44YDr6Z]]Das Buch [https://amzn.to/44YDr6Z Wissensorientierte Unternehmensführung] (*) von Prof. [https://www.linkedin.com/in/klaus-north-32483b112/ Klaus North] bietet einen umfassenden Überblick zum Thema [[Wissensmanagement]] und beantwortet zentrale Fragen rund um den Produktionsfaktor Wissen in Unternehmen. Zentrale Herausforderungen ergeben sich durch den Wandel von arbeitsintensiven zu wissensintensiven Geschäftsfeldern, getrieben von Globalisierung, Innovationsdruck und technologischen Entwicklungen. Das Ziel ist die Sicherstellung, Nutzung, Entwicklung und Absicherung des unternehmensrelevanten Wissens, das als entscheidender Wettbewerbsfaktor gilt. Hindernisse entstehen durch restriktive Organisationsstrukturen, fehlende Anreize zur Wissensteilung und ineffiziente Prozesse. Der Aufbau einer wissensfördernden Unternehmenskultur, die Schaffung transparenter Wissensmärkte sowie die gezielte Implementierung von Wissensmanagement-Initiativen sind entscheidende Erfolgsfaktoren. | ||
Das Buch [https://amzn.to/44YDr6Z Wissensorientierte Unternehmensführung] (*) von Klaus North | |||
== | == Zusammenfassung == | ||
=== | === Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft === | ||
Die Wissensgesellschaft ist durch einen strukturellen Wandel hin zu wissens- und informationsintensiven Aktivitäten gekennzeichnet. Drei Haupttriebkräfte – struktureller Wandel, Globalisierung und technologische Innovation – führen dazu, dass Wissen die zentrale Ressource für Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit wird. Unternehmen entwickeln sich von physischen zu virtuellen, netzwerkartigen Gebilden und müssen sich durch Innovation und die Fähigkeit, neues Wissen zu generieren und zu nutzen, differenzieren. Fallbeispiele wie das Ingenieurbüro K&P zeigen, wie die Digitalisierung und systematische Dokumentation von Wissen zu einem kollektiven Lernprozess führen kann. Herausforderungen bestehen weiterhin in der Überwindung von Wissenssilos, dem „not invented here“-Syndrom und fehlenden Anreizen für den Wissenstransfer. Die Fähigkeit, Wissen international zu steuern und zu transferieren, wird zur Schlüsselkompetenz für Unternehmen. | |||
=== | === Die Wissenstreppe === | ||
Wissen | Die Wissenstreppe differenziert zwischen Daten, [[Information|Informationen]], [[Wissen]] und [[Kompetenz]] und stellt diese Begriffe in Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit. Organisationen verfügen über unterschiedliche Wissenskategorien, die sich aus Strategie, Markt, Kunden, Produkten, Prozessen, Technologien und Organisationswissen zusammensetzen. Die zentrale Aufgabe besteht darin, aus Informationen anwendungsbezogenes Wissen zu generieren und dieses in messbare Wettbewerbsvorteile umzusetzen. Die Transformation von implizitem in explizites Wissen und die Strukturierung des intellektuellen Kapitals sind wesentliche Bestandteile dieses Ansatzes. | ||
=== | === Organisieren rund ums Wissen === | ||
Wissensorientierte Unternehmensführung erfordert neue Organisationsformen und die Fähigkeit, zwischen Stabilität und Erneuerung, Konkurrenz und Kooperation sowie Hierarchie und Netzwerk zu balancieren. Verschiedene Organisationsmodelle wie die „Sternexplosion-Organisation“, Spinnennetz-Organisation, Plattformorganisation oder Hypertext-Organisation werden vorgestellt. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind die Förderung von Wissensallianzen, die Integration von Gruppen- und Projektarbeit sowie die Nutzung kooperativer und flexibler Strukturen. Informelle Netzwerke, Kompetenzzentren und Communities of Practice unterstützen die Entwicklung und den Transfer von Wissen. | |||
=== | === Wissen ist menschlich === | ||
Im Zentrum des Wissensmanagements stehen die Menschen mit ihren Kompetenzen, ihrer Motivation und ihrem Beitrag zur kollektiven Intelligenz. Neue Rollenverständnisse entstehen: Wissensarbeiter, Führungskräfte, Fachspezialisten, Informationsbroker und Support-Mitarbeitende. Motivation für Wissensteilung, Entwicklung von Kompetenzen und die Etablierung einer vertrauensvollen, offenen Unternehmenskultur sind entscheidend. Die Kompetenzentwicklung wird systematisch durch Kompetenzmatrizen und -profile gesteuert, und der Aufbau von Wissensgemeinschaften ([[Community of Practice|Communities of Practice]]) wird als wichtiger Hebel für den Austausch und die Entwicklung von Wissen hervorgehoben. | |||
=== | === Wissen aufbauen und teilen === | ||
Das Wissensmanagement umfasst die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der organisationalen [[Wissensbasis]]. Verschiedene Modelle wie die Bausteine des Wissensmanagements, das Münchener Modell, das Lebenszyklusmodell, das Wissensmarkt-Modell und das Modell der Wissensspirale werden beschrieben und verglichen. Die Bedeutung des Wissensmanagements in internationalen und kleinen sowie mittleren Unternehmen wird hervorgehoben. Erfolgsfaktoren sind Wissensbeschaffung, -entwicklung, -transfer, -aneignung, -weiterentwicklung und -absicherung. Der gezielte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Aufbau effektiver Wissensnetzwerke sind dabei zentral. | |||
=== | === Wissen messen und absichern === | ||
Die Messung von Wissen und die Entwicklung von Wissensbilanzen sind Voraussetzung für die Sichtbarkeit und Steuerung der Wissensressourcen. Methoden wie die [[Balanced Scorecard]], [[Wissensbilanz|Wissensbilanzen]] (deduktiv und induktiv) sowie verschiedene Indikatoren für Kunden-, Mitarbeiter-, Prozess-, Innovations- und Finanzkapital werden vorgestellt. Die Absicherung des Wissens vor Verlust, zum Beispiel durch systematische Wissenssicherung bei Personalwechsel oder die Sicherung von Patenten, wird thematisiert. Die Bewertung der verschiedenen Verfahren betont die Notwendigkeit, Wissen als immateriellen Vermögenswert zu begreifen und systematisch zu schützen. | |||
=== | === Wissensmanagement implementieren === | ||
Die Implementierung des Wissensmanagements erfolgt über eine wissensorientierte Strategie, das [[Wissensmarkt]]-Konzept sowie die Gestaltung von Rahmenbedingungen und Anreizsystemen. Fünf zentrale Lehren werden für die Gestaltung des Wissensmanagements hervorgehoben. Die Rollen der Akteure und die Spielregeln im Wissensmarkt werden definiert. Instrumente wie Best-Practice-Prozesse, [[Lessons Learned]], Kompetenznetzwerke, sowie der gezielte Einsatz von IT- und Kommunikationssystemen für das Unternehmen 4.0 spielen eine zentrale Rolle. Verschiedene Einführungspfade, ein 12-Punkte-Programm sowie die Ableitung konkreter Arbeitspakete aus der Wissenstreppe werden als praktische Vorgehensweisen vorgeschlagen. | |||
=== | === Anhang: Wissensmarkt === | ||
Der Anhang erläutert das Konzept des Wissensmarkts im Detail: Voraussetzungen, Gestaltung, Ablauf und Nutzung im Unternehmen. Der Wissensmarkt dient als Plattform für das Zusammentreffen von Wissensanbietern und -nachfragern, fördert Transparenz über vorhandenes Wissen und schafft Anreize für Austausch und Entwicklung. Tipps zur Vorbereitung und Durchführung von Wissensmärkten werden praxisorientiert beschrieben. | |||
== Fallbeispiele == | == Fallbeispiele == | ||
Version vom 29. Mai 2025, 15:18 Uhr
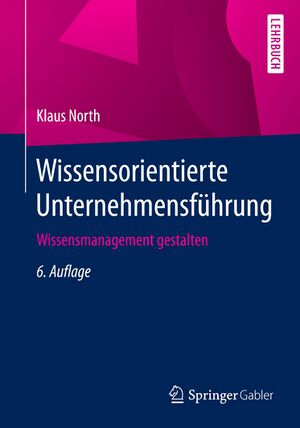
Das Buch Wissensorientierte Unternehmensführung (*) von Prof. Klaus North bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Wissensmanagement und beantwortet zentrale Fragen rund um den Produktionsfaktor Wissen in Unternehmen. Zentrale Herausforderungen ergeben sich durch den Wandel von arbeitsintensiven zu wissensintensiven Geschäftsfeldern, getrieben von Globalisierung, Innovationsdruck und technologischen Entwicklungen. Das Ziel ist die Sicherstellung, Nutzung, Entwicklung und Absicherung des unternehmensrelevanten Wissens, das als entscheidender Wettbewerbsfaktor gilt. Hindernisse entstehen durch restriktive Organisationsstrukturen, fehlende Anreize zur Wissensteilung und ineffiziente Prozesse. Der Aufbau einer wissensfördernden Unternehmenskultur, die Schaffung transparenter Wissensmärkte sowie die gezielte Implementierung von Wissensmanagement-Initiativen sind entscheidende Erfolgsfaktoren.
Zusammenfassung
Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft
Die Wissensgesellschaft ist durch einen strukturellen Wandel hin zu wissens- und informationsintensiven Aktivitäten gekennzeichnet. Drei Haupttriebkräfte – struktureller Wandel, Globalisierung und technologische Innovation – führen dazu, dass Wissen die zentrale Ressource für Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit wird. Unternehmen entwickeln sich von physischen zu virtuellen, netzwerkartigen Gebilden und müssen sich durch Innovation und die Fähigkeit, neues Wissen zu generieren und zu nutzen, differenzieren. Fallbeispiele wie das Ingenieurbüro K&P zeigen, wie die Digitalisierung und systematische Dokumentation von Wissen zu einem kollektiven Lernprozess führen kann. Herausforderungen bestehen weiterhin in der Überwindung von Wissenssilos, dem „not invented here“-Syndrom und fehlenden Anreizen für den Wissenstransfer. Die Fähigkeit, Wissen international zu steuern und zu transferieren, wird zur Schlüsselkompetenz für Unternehmen.
Die Wissenstreppe
Die Wissenstreppe differenziert zwischen Daten, Informationen, Wissen und Kompetenz und stellt diese Begriffe in Bezug zur Wettbewerbsfähigkeit. Organisationen verfügen über unterschiedliche Wissenskategorien, die sich aus Strategie, Markt, Kunden, Produkten, Prozessen, Technologien und Organisationswissen zusammensetzen. Die zentrale Aufgabe besteht darin, aus Informationen anwendungsbezogenes Wissen zu generieren und dieses in messbare Wettbewerbsvorteile umzusetzen. Die Transformation von implizitem in explizites Wissen und die Strukturierung des intellektuellen Kapitals sind wesentliche Bestandteile dieses Ansatzes.
Organisieren rund ums Wissen
Wissensorientierte Unternehmensführung erfordert neue Organisationsformen und die Fähigkeit, zwischen Stabilität und Erneuerung, Konkurrenz und Kooperation sowie Hierarchie und Netzwerk zu balancieren. Verschiedene Organisationsmodelle wie die „Sternexplosion-Organisation“, Spinnennetz-Organisation, Plattformorganisation oder Hypertext-Organisation werden vorgestellt. Entscheidende Erfolgsfaktoren sind die Förderung von Wissensallianzen, die Integration von Gruppen- und Projektarbeit sowie die Nutzung kooperativer und flexibler Strukturen. Informelle Netzwerke, Kompetenzzentren und Communities of Practice unterstützen die Entwicklung und den Transfer von Wissen.
Wissen ist menschlich
Im Zentrum des Wissensmanagements stehen die Menschen mit ihren Kompetenzen, ihrer Motivation und ihrem Beitrag zur kollektiven Intelligenz. Neue Rollenverständnisse entstehen: Wissensarbeiter, Führungskräfte, Fachspezialisten, Informationsbroker und Support-Mitarbeitende. Motivation für Wissensteilung, Entwicklung von Kompetenzen und die Etablierung einer vertrauensvollen, offenen Unternehmenskultur sind entscheidend. Die Kompetenzentwicklung wird systematisch durch Kompetenzmatrizen und -profile gesteuert, und der Aufbau von Wissensgemeinschaften (Communities of Practice) wird als wichtiger Hebel für den Austausch und die Entwicklung von Wissen hervorgehoben.
Wissen aufbauen und teilen
Das Wissensmanagement umfasst die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der organisationalen Wissensbasis. Verschiedene Modelle wie die Bausteine des Wissensmanagements, das Münchener Modell, das Lebenszyklusmodell, das Wissensmarkt-Modell und das Modell der Wissensspirale werden beschrieben und verglichen. Die Bedeutung des Wissensmanagements in internationalen und kleinen sowie mittleren Unternehmen wird hervorgehoben. Erfolgsfaktoren sind Wissensbeschaffung, -entwicklung, -transfer, -aneignung, -weiterentwicklung und -absicherung. Der gezielte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der Aufbau effektiver Wissensnetzwerke sind dabei zentral.
Wissen messen und absichern
Die Messung von Wissen und die Entwicklung von Wissensbilanzen sind Voraussetzung für die Sichtbarkeit und Steuerung der Wissensressourcen. Methoden wie die Balanced Scorecard, Wissensbilanzen (deduktiv und induktiv) sowie verschiedene Indikatoren für Kunden-, Mitarbeiter-, Prozess-, Innovations- und Finanzkapital werden vorgestellt. Die Absicherung des Wissens vor Verlust, zum Beispiel durch systematische Wissenssicherung bei Personalwechsel oder die Sicherung von Patenten, wird thematisiert. Die Bewertung der verschiedenen Verfahren betont die Notwendigkeit, Wissen als immateriellen Vermögenswert zu begreifen und systematisch zu schützen.
Wissensmanagement implementieren
Die Implementierung des Wissensmanagements erfolgt über eine wissensorientierte Strategie, das Wissensmarkt-Konzept sowie die Gestaltung von Rahmenbedingungen und Anreizsystemen. Fünf zentrale Lehren werden für die Gestaltung des Wissensmanagements hervorgehoben. Die Rollen der Akteure und die Spielregeln im Wissensmarkt werden definiert. Instrumente wie Best-Practice-Prozesse, Lessons Learned, Kompetenznetzwerke, sowie der gezielte Einsatz von IT- und Kommunikationssystemen für das Unternehmen 4.0 spielen eine zentrale Rolle. Verschiedene Einführungspfade, ein 12-Punkte-Programm sowie die Ableitung konkreter Arbeitspakete aus der Wissenstreppe werden als praktische Vorgehensweisen vorgeschlagen.
Anhang: Wissensmarkt
Der Anhang erläutert das Konzept des Wissensmarkts im Detail: Voraussetzungen, Gestaltung, Ablauf und Nutzung im Unternehmen. Der Wissensmarkt dient als Plattform für das Zusammentreffen von Wissensanbietern und -nachfragern, fördert Transparenz über vorhandenes Wissen und schafft Anreize für Austausch und Entwicklung. Tipps zur Vorbereitung und Durchführung von Wissensmärkten werden praxisorientiert beschrieben.
Fallbeispiele
Folgende Fallbeispiele werden in dem Buch besprochen:
- Ingenieurbüro K&P: Schnell lernen
- Produktionsimpresarios: Virtuell und Virtuos
- Best-Practice-Transfer (Elektronikfertigung)
- Bessere Nutzung von Patenten bei Dox-Chemical
- Wissensintegration: Übernahme eines ausländischen Unternehmens
- Das beste Brot in ganz Osaka
- Story Telling - Geschichten transportieren implizites Wissens
- Der Wert des Wissens
- Oticon - Die Spaghetti-Organisation
- Allianz Group Business Services (AGBS) fördert Wissens-Synergien
- Merill Lynch: Finanzdienstleistungen replizieren
- NovaCare - Die Rehabilitationsdienstleister
- 3M - Der Produktgenerator
- MLP Finanzdienstleistungen als Wissensnetzwerk
- KAO - Kreative in Japan
- Sharp - Hypertext in F&E
- Olivetti als Plattformorganisation
- Die "Workforce 21" - Initiative von AT&T
- Eine fiktive Stellenanzeige der "Intelligenz AG"
- CSC Ploenzke: Personalentwicklung mit Perspektive
- Experten finden und verbinden bei Sanofi-Aventis
- Karriere in der CSC-Welt: Wertvoller werden
- Das Unternehmensfrühstück
- "Wissen teilen gewinnt Meilen" - Initiative in einer Unternehmensberatung
- Wissensgemeinschaften: Zwei Beispiele
- Info: Die No-Frill-Community
- Wissensarbeit weltweit
- GTZ: Aus weltweiten Projekterfahrungen zu Dienstleistungsprodukten
- Gemeinsam lernen im Handwerk: Die bad & heizung concept AG
- Ein Modellprojekt in Hessen
- Wissensbilanz des Forschungszentrum Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS)
- Wissensbilanz einer Bausparkasse
- Die Wissensstafette von Volkswagen
- Individual Inc. Clipping-Service: Wissen über Kunden bindet Kunden
- Mit "Sinn" Wissen managen
- Die Weltmarken Kulturvertrag
- Der Wissensbroker - Beispiel der Siemens Business Services (SBS)
- Leuchtturmprinzip: Das Programm Klassenbester
- Beispiele von Wissensintegrationsprozessen
- Beispiele für Kompetzenznetzwerke
- General Electric - Workout
- Bereichsübergreifendes Projekt "Komplexitätsreduktion von Baugruppen"
- Das Intranet als Wissensmarkt
- I+K in der Luftfahrt-Branche
- Kompetenznetzwerke im Elektronikkonzern
Weblinks
- Wissensorientierte Unternehmensführung bei Google Buchsuche
- Wissensorientierte Unternehmensführung bei Amazon Search Inside
- PDF-Foliensatz von Klaus North: Darstellung der Wissensorientierten Unternehmensführung nach North als Vorgehensmodell nach den Konzepten des V-Modells XT
- Ergebnisse des Modellprojekts zur Erprobung von Wissensmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen