The tacit dimension
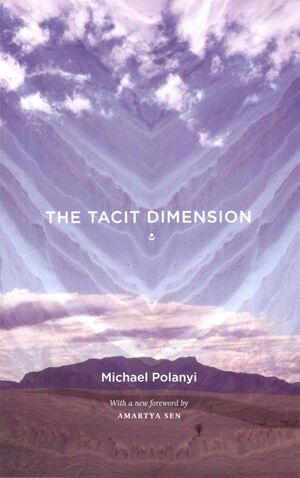
Michael Polanyi erläutert in der Einleitung von The Tacit Dimension (*) den Ursprung und die Entwicklung seiner zentralen Fragestellung: Was ist menschliches Wissen und wie wird es begründet? Polanyi reflektiert seine wissenschaftlichen und philosophischen Stationen und beschreibt, wie seine Theorie des „tacit knowing“ (stillschweigendes Wissen) als Gegenentwurf zu rein explizitem, formalisiertem Wissen entstand. Er betont, dass alles Denken eine *from-to*-Struktur besitzt, bei der der Mensch von bestimmten Elementen (Subsidiaries) zu einem Gesamtinhalt (Focal Content) gelangt. Dies führt zu der Einsicht, dass Wissen nicht vollständig explizit gemacht werden kann und existenziell verankert ist. Polanyi argumentiert, dass neue Werte und Erkenntnisse nicht bewusst gewählt, sondern implizit durch Handeln und kreative Prozesse angenommen werden. Die Einleitung setzt somit den Rahmen für eine umfassende Untersuchung des stillschweigenden Wissens als Grundstruktur allen Denkens und Handelns.
Zusammenfassung
Tacit Knowing
Polanyi führt das zentrale Konzept des stillschweigenden Wissens ein: Menschen können mehr wissen, als sie ausdrücken oder erklären können („We can know more than we can tell“). Anhand von Beispielen wie Gesichtserkennung, medizinischer Diagnose und dem Gebrauch von Werkzeugen zeigt er, dass Wissen oft nicht vollständig explizit artikuliert werden kann, sondern durch praktische Erfahrung, Intuition und Integration von Einzelteilen entsteht. Er analysiert die Struktur des stillschweigenden Wissens als ein Zusammenspiel von zwei Polen: das Proximale (die Einzelheiten) und das Distale (das Gesamtbild). Wissen entsteht dadurch, dass man *von* den Einzelheiten *zu* einer Bedeutung oder einem Ganzen „hinüberschaltet“. Diese Integration ist ein aktiver, kreativer Prozess.
Polanyi erläutert die funktionale, phänomenale und semantische Struktur von tacit knowing. Indem wir uns mit Werkzeugen, Sprache oder Theorien vertraut machen („indwelling“), werden diese Teil unseres eigenen Körpers oder Geistes und ermöglichen es uns, Bedeutungen zu erfassen, die nicht analytisch zerlegbar sind. Übermäßige Explikation kann das Verständnis zerstören; erst durch erneute Integration gewinnen die Einzelheiten wieder Sinn. Das gilt auch für wissenschaftliche Entdeckungen, die auf der Vorahnung von Problemen oder Lösungen basieren, deren genaue Form noch unbekannt ist. Polanyi argumentiert, dass Wissenschaftler sich auf ein „verborgenes“ Problem einlassen und durch ihre persönliche Intuition und Hingabe zur Entdeckung gelangen – ein Prozess, der sich jeder vollständigen Formalisierung entzieht. Wissenschaftliches Wissen ist daher immer auch persönlich, verantwortungsvoll und auf einen realen, aber nicht vollständig fassbaren Gegenstand bezogen.
Emergence
Polanyi erweitert das Konzept des tacit knowing auf die Strukturen und Hierarchien von Wissen und Realität. Er zeigt, dass komplexe Gebilde – von Maschinen über sprachliche Strukturen bis zu lebenden Organismen – durch die Integration verschiedener Ebenen („strata“) entstehen, wobei jede höhere Ebene die Möglichkeiten der darunterliegenden nutzt, aber nicht auf deren Gesetze reduzierbar ist. Die Prinzipien einer Maschine, eines Kunstwerks oder eines Lebewesens lassen sich nicht allein aus den Gesetzen der Einzelteile ableiten; sie erfordern das Verständnis ihrer „emergenten“ Struktur.
Im Bereich der Biologie unterscheidet Polanyi zwischen mechanistischen und organischen (organismic) Prinzipien. Lebensprozesse beinhalten sowohl mechanische Strukturen als auch regulative, organismische Prinzipien, die über die reine Physik und Chemie hinausgehen. Anhand von Beispielen wie der Regeneration beim Seeigel zeigt er, dass Lebensformen zu neuen, höheren Ordnungen „emergieren“, die in ihrem Aufbau nicht vollständig aus den Gesetzen des Unterbaus abgeleitet werden können.
Auf geistiger Ebene beschreibt Polanyi, wie Kinder durch tacit knowing und soziale Prozesse immer komplexere kognitive Strukturen aufbauen. Evolution ist für ihn ein Prozess fortlaufender Emergenz, in dem sich neue Ebenen von Bedeutung und Fähigkeit aus den bestehenden herausbilden. Jeder Fortschritt bringt neue Möglichkeiten, aber auch neue Fehlerquellen und Verantwortlichkeiten mit sich. Moralische Fähigkeiten des Menschen sind dabei eine besondere Ausprägung dieser emergenten Hierarchie, die in der evolutionären Entwicklung eine zentrale Rolle einnehmen.
A Society Of Explorers
Im dritten Kapitel verbindet Polanyi seine Erkenntnisse über tacit knowing und Emergenz mit gesellschaftlichen und kulturellen Fragen. Er argumentiert, dass Wissenschaft, Kunst und moralische Entwicklung auf Tradition, implizitem Wissen und wechselseitiger Kontrolle beruhen. Die moderne Wissenschaft ist nicht ein System vollständig expliziten, nachprüfbaren Wissens, sondern lebt von der stillschweigenden Weitergabe von Praktiken, von gegenseitiger Begutachtung und von einem gemeinsamen Glauben an die Realität und Bedeutung wissenschaftlicher Tätigkeit.
Polanyi entwickelt das Bild einer „Gesellschaft der Entdecker“ (Society of Explorers), in der individuelle Kreativität und Originalität durch eine geteilte Tradition und gegenseitige Kontrolle ermöglicht und begrenzt werden. Wissenschaftler arbeiten unabhängig, sind jedoch eingebettet in ein Netzwerk gegenseitiger Autorität, das Standards setzt und Innovationen bewertet. Diese Struktur fördert sowohl Disziplin als auch Originalität und ist nicht nur auf die Wissenschaft beschränkt, sondern gilt auch für Kunst, Literatur und Moral. Der Anspruch auf absolute Selbstbestimmung und Perfektionismus, wie er im Existentialismus oder politischem Utopismus vorkommt, wird von Polanyi als destruktiv kritisiert. Stattdessen plädiert er für die Anerkennung von Grenzen und für verantwortungsbewusste, auf Entdeckung und Wachstum ausgerichtete Handlung.
Polanyi schließt mit einer kosmischen Perspektive: Die Geschichte der Emergenz – von der Materie über das Leben zum Denken und zur Kultur – ist ein fortlaufender Prozess kreativer Entfaltung, der uns Sinn und Ziel verleiht. Individuelle Freiheit und gesellschaftliche Entwicklung erfordern dabei ein Gleichgewicht zwischen Tradition, Innovation und moralischer Verantwortung.