The knowledge-creating company: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Datei:Cover-The-Knowledge-Creating-Company.jpg|mini|link=https://amzn.to/3FgNfPs]] | ||
Im Buch [https://amzn.to/3FgNfPs The Knowledge-Creating Company] (*)beschreiben Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi, dass japanische Unternehmen im Westen oft als wenig effizient, aber dennoch innovativ und wettbewerbsfähig betrachtet werden. Die Autoren argumentieren, dass ihr Erfolg weniger auf bekannten Faktoren wie Fertigungskompetenz oder günstigen Kapitalzugang zurückzuführen ist, sondern auf ihrer Fähigkeit zur '''organisationalen Wissensschaffung''': das Unternehmen als Ganzes generiert neues Wissen, verbreitet es intern und setzt es in Produkten, Dienstleistungen und Systemen um. Innovation findet kontinuierlich und spiralförmig statt, wobei externe Unsicherheit und Krisen zur Suche und Integration von externem Wissen führen. Entscheidend ist die Konvertierung von externem Wissen in internes und die ständige Verbindung zwischen Außen und Innen. Die Autoren betonen, dass nicht nur explizites (formalisierbares), sondern vor allem '''tacit knowledge''' (implizites, erfahrungsbasiertes Wissen) den Wettbewerbsvorteil ausmacht. Die Interaktion zwischen explizitem und implizitem Wissen ist die Triebkraft der Wissensgenerierung. Der Wandel im Denken: Unternehmen verarbeiten nicht nur Wissen, sondern erschaffen es aktiv. | |||
== Zusammenfassung == | |||
== | === Knowledge and Management === | ||
... | Dieses Kapitel kontrastiert westliche und japanische Wissenskonzepte anhand ihrer epistemologischen Traditionen. Die westliche Philosophie, von Descartes geprägt, trennt Subjekt und Objekt (Geist vs. Körper) und bevorzugt explizites Wissen, während die japanische Tradition auf der Einheit von Mensch und Natur, Körper und Geist sowie von Selbst und Anderem beruht. Im Management zeigt sich dies in der Betonung von individueller und kollektiver Erfahrung, Körperlichkeit und Intuition. Westliche Managementtheorien behandeln Wissen meist als Ressource, die verwaltet wird, selten als etwas, das aktiv erschaffen wird. Ansätze wie Scientific Management (Taylor), Human Relations (Mayo), die Organisationstheorie (Simon), Sensemaking (Weick) und Strategie-Modelle (Porter, Prahalad & Hamel) werden kritisch analysiert. Die Autoren zeigen, dass viele Theorien den kreativen, aktiven Aspekt von Wissensgenerierung und die Rolle von „tacit knowledge“ vernachlässigen. Erst moderne Ansätze wie die Lernende Organisation (Senge) oder Resource-Based-View (Prahalad & Hamel) nähern sich dem japanischen Verständnis, gehen aber selten systematisch auf die aktive Wissensschaffung ein. | ||
== | === Theory of Organizational Knowledge Creation === | ||
Im Zentrum steht das SECI-Modell (Socialization, Externalization, Combination, Internalization), das vier Modi der Wissenskonversion beschreibt: | |||
* '''Sozialisation (tacit zu tacit):''' Teilen von Erfahrungen, oft informell (z.B. Meister-Lehrling-Prinzip). | |||
... | * '''Externalisierung (tacit zu explizit):''' Implizites Wissen wird durch Metaphern, Analogien und Modelle artikuliert (z.B. Honda City: „man-maximum, machine-minimum“). | ||
* '''Kombination (explizit zu explizit):''' Explizites Wissen wird systematisiert, neu kombiniert, dokumentiert und verbreitet. | |||
* '''Internalisierung (explizit zu tacit):''' Explizites Wissen wird durch Praxis, Übung und „learning by doing“ internalisiert. | |||
Wissensgenerierung ist ein spiralförmiger Prozess zwischen Individuum, Gruppe und Organisation, wobei Teams eine Schlüsselrolle spielen. Die Transformation von individuellem Wissen zu organisationalem Wissen erfolgt durch Dialog, Diskussion und geteilte Erfahrungen. Ambiguität, Redundanz und ein gemeinsamer Kontext fördern den Prozess. Wissensgenerierung ist kollektiv, emergent und von Metaphern und symbolischer Sprache getragen. | |||
... | |||
== | === Creating Knowledge in Practice === | ||
Anhand praktischer Fallstudien (z.B. Matsushita – Entwicklung der Brotbackmaschine „Home Bakery“) wird gezeigt, wie Wissenskreation auf allen Ebenen und als kontinuierlicher Prozess abläuft. Persönliches Erfahrungswissen wird durch intensiven Austausch und iterative Zyklen in organisationales Wissen transformiert. Die Wissensspirale setzt sich auch nach erfolgreichen Innovationen fort und stößt Veränderungen in anderen Unternehmensbereichen an. | |||
== | === Middle-up-down Management Process for Knowledge Creation === | ||
Die Autoren stellen das „middle-up-down“-Managementmodell vor, das zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen vermittelt. '''Mittleres Management''' spielt die Schlüsselrolle als Wissensingenieure: Sie synthetisieren Wissen aus der Basis und der Führungsebene, machen es explizit und treiben die Umsetzung in Produkte und Prozesse voran. Drei Managementmodelle werden verglichen (GE, 3M, Canon); das „middle-up-down“-Modell zeigt sich als besonders geeignet, um die Dynamik der Wissensschaffung zu fördern, indem es visionäre Ideale mit operativer Realität verknüpft. | |||
=== A New Organizational Structure === | |||
Weder reine Hierarchie noch lose Task Forces bieten optimale Bedingungen für Wissensgenerierung. Die Autoren schlagen die „Hypertext Organization“ vor: eine flexible Struktur, die formale Hierarchie mit projektorientierter Arbeit kombiniert. Beispiele aus Sharp und Kao zeigen, wie sich Effizienz und Flexibilität vereinen lassen, um den Austausch und die Verbreitung von Wissen im Unternehmen zu maximieren. | |||
=== Global Organizational Knowledge Creation === | |||
Wissensgenerierung kann auch global und organisationsübergreifend erfolgen. Am Beispiel von Nissan (Entwicklung des „Primera“) und Shin Caterpillar Mitsubishi wird gezeigt, wie Wissenskreation grenzüberschreitend – innerhalb internationaler Unternehmen und zwischen Partnern – funktioniert. Schlüssel ist die Integration verschiedener kultureller und organisationaler Kontexte, um neues Wissen zu erzeugen. | |||
=== Managerial and Theoretical Implications === | |||
Abschließend werden praktische Implikationen für Manager sowie theoretische Konsequenzen diskutiert. Unternehmen sollten alle Mitarbeitenden als „knowledge crew“ begreifen und systematisch in die Wissensgenerierung einbinden. Die Fähigkeit, kontinuierlich neues Wissen zu schaffen, wird zur Kernkompetenz. Theoretisch zeigen die Autoren, dass erfolgreiche Wissensgenerierung die Überwindung klassischer Dichotomien erfordert: Körper vs. Geist, tacit vs. explizit, Individuum vs. Organisation, Ost vs. West. Das vorgestellte Modell der Wissensspirale und das Verständnis der Interaktionen zwischen Wissenstypen und -ebenen bieten eine robuste Grundlage für weitere Forschung und Managementpraxis. | |||
Version vom 29. Mai 2025, 16:13 Uhr
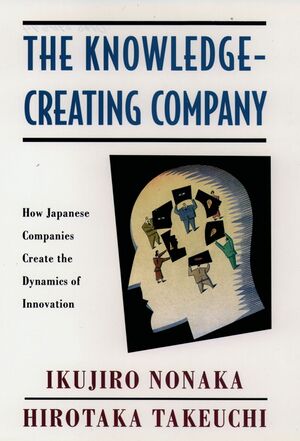
Im Buch The Knowledge-Creating Company (*)beschreiben Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi, dass japanische Unternehmen im Westen oft als wenig effizient, aber dennoch innovativ und wettbewerbsfähig betrachtet werden. Die Autoren argumentieren, dass ihr Erfolg weniger auf bekannten Faktoren wie Fertigungskompetenz oder günstigen Kapitalzugang zurückzuführen ist, sondern auf ihrer Fähigkeit zur organisationalen Wissensschaffung: das Unternehmen als Ganzes generiert neues Wissen, verbreitet es intern und setzt es in Produkten, Dienstleistungen und Systemen um. Innovation findet kontinuierlich und spiralförmig statt, wobei externe Unsicherheit und Krisen zur Suche und Integration von externem Wissen führen. Entscheidend ist die Konvertierung von externem Wissen in internes und die ständige Verbindung zwischen Außen und Innen. Die Autoren betonen, dass nicht nur explizites (formalisierbares), sondern vor allem tacit knowledge (implizites, erfahrungsbasiertes Wissen) den Wettbewerbsvorteil ausmacht. Die Interaktion zwischen explizitem und implizitem Wissen ist die Triebkraft der Wissensgenerierung. Der Wandel im Denken: Unternehmen verarbeiten nicht nur Wissen, sondern erschaffen es aktiv.
Zusammenfassung
Knowledge and Management
Dieses Kapitel kontrastiert westliche und japanische Wissenskonzepte anhand ihrer epistemologischen Traditionen. Die westliche Philosophie, von Descartes geprägt, trennt Subjekt und Objekt (Geist vs. Körper) und bevorzugt explizites Wissen, während die japanische Tradition auf der Einheit von Mensch und Natur, Körper und Geist sowie von Selbst und Anderem beruht. Im Management zeigt sich dies in der Betonung von individueller und kollektiver Erfahrung, Körperlichkeit und Intuition. Westliche Managementtheorien behandeln Wissen meist als Ressource, die verwaltet wird, selten als etwas, das aktiv erschaffen wird. Ansätze wie Scientific Management (Taylor), Human Relations (Mayo), die Organisationstheorie (Simon), Sensemaking (Weick) und Strategie-Modelle (Porter, Prahalad & Hamel) werden kritisch analysiert. Die Autoren zeigen, dass viele Theorien den kreativen, aktiven Aspekt von Wissensgenerierung und die Rolle von „tacit knowledge“ vernachlässigen. Erst moderne Ansätze wie die Lernende Organisation (Senge) oder Resource-Based-View (Prahalad & Hamel) nähern sich dem japanischen Verständnis, gehen aber selten systematisch auf die aktive Wissensschaffung ein.
Theory of Organizational Knowledge Creation
Im Zentrum steht das SECI-Modell (Socialization, Externalization, Combination, Internalization), das vier Modi der Wissenskonversion beschreibt:
- Sozialisation (tacit zu tacit): Teilen von Erfahrungen, oft informell (z.B. Meister-Lehrling-Prinzip).
- Externalisierung (tacit zu explizit): Implizites Wissen wird durch Metaphern, Analogien und Modelle artikuliert (z.B. Honda City: „man-maximum, machine-minimum“).
- Kombination (explizit zu explizit): Explizites Wissen wird systematisiert, neu kombiniert, dokumentiert und verbreitet.
- Internalisierung (explizit zu tacit): Explizites Wissen wird durch Praxis, Übung und „learning by doing“ internalisiert.
Wissensgenerierung ist ein spiralförmiger Prozess zwischen Individuum, Gruppe und Organisation, wobei Teams eine Schlüsselrolle spielen. Die Transformation von individuellem Wissen zu organisationalem Wissen erfolgt durch Dialog, Diskussion und geteilte Erfahrungen. Ambiguität, Redundanz und ein gemeinsamer Kontext fördern den Prozess. Wissensgenerierung ist kollektiv, emergent und von Metaphern und symbolischer Sprache getragen.
Creating Knowledge in Practice
Anhand praktischer Fallstudien (z.B. Matsushita – Entwicklung der Brotbackmaschine „Home Bakery“) wird gezeigt, wie Wissenskreation auf allen Ebenen und als kontinuierlicher Prozess abläuft. Persönliches Erfahrungswissen wird durch intensiven Austausch und iterative Zyklen in organisationales Wissen transformiert. Die Wissensspirale setzt sich auch nach erfolgreichen Innovationen fort und stößt Veränderungen in anderen Unternehmensbereichen an.
Middle-up-down Management Process for Knowledge Creation
Die Autoren stellen das „middle-up-down“-Managementmodell vor, das zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Ansätzen vermittelt. Mittleres Management spielt die Schlüsselrolle als Wissensingenieure: Sie synthetisieren Wissen aus der Basis und der Führungsebene, machen es explizit und treiben die Umsetzung in Produkte und Prozesse voran. Drei Managementmodelle werden verglichen (GE, 3M, Canon); das „middle-up-down“-Modell zeigt sich als besonders geeignet, um die Dynamik der Wissensschaffung zu fördern, indem es visionäre Ideale mit operativer Realität verknüpft.
A New Organizational Structure
Weder reine Hierarchie noch lose Task Forces bieten optimale Bedingungen für Wissensgenerierung. Die Autoren schlagen die „Hypertext Organization“ vor: eine flexible Struktur, die formale Hierarchie mit projektorientierter Arbeit kombiniert. Beispiele aus Sharp und Kao zeigen, wie sich Effizienz und Flexibilität vereinen lassen, um den Austausch und die Verbreitung von Wissen im Unternehmen zu maximieren.
Global Organizational Knowledge Creation
Wissensgenerierung kann auch global und organisationsübergreifend erfolgen. Am Beispiel von Nissan (Entwicklung des „Primera“) und Shin Caterpillar Mitsubishi wird gezeigt, wie Wissenskreation grenzüberschreitend – innerhalb internationaler Unternehmen und zwischen Partnern – funktioniert. Schlüssel ist die Integration verschiedener kultureller und organisationaler Kontexte, um neues Wissen zu erzeugen.
Managerial and Theoretical Implications
Abschließend werden praktische Implikationen für Manager sowie theoretische Konsequenzen diskutiert. Unternehmen sollten alle Mitarbeitenden als „knowledge crew“ begreifen und systematisch in die Wissensgenerierung einbinden. Die Fähigkeit, kontinuierlich neues Wissen zu schaffen, wird zur Kernkompetenz. Theoretisch zeigen die Autoren, dass erfolgreiche Wissensgenerierung die Überwindung klassischer Dichotomien erfordert: Körper vs. Geist, tacit vs. explizit, Individuum vs. Organisation, Ost vs. West. Das vorgestellte Modell der Wissensspirale und das Verständnis der Interaktionen zwischen Wissenstypen und -ebenen bieten eine robuste Grundlage für weitere Forschung und Managementpraxis.